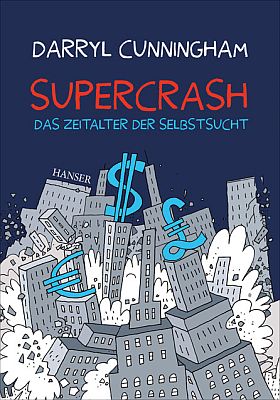
Finanzkrise! Dieses finstere Gespenst erschien 2007 langsam am Himmel, als der amerikanische Immobilienmarkt ins Wackeln kam, bis 2008 schließlich das doch eigentlich Undenkbare geschah: mit Bear Stearns und kurz darauf Lehman Brothers brachen zwei traditionsreiche Investmentbanken zusammen, was der letzte Stein des Anstoßes eines weltweiten Strudels wurde, aus dem man sich bis heute mühselig befreit. An Erklärungsversuchen, wie das alles geschehen konnte und warum es eigentlich so schlimm war, dass in Florida ein paar Hauskredite platzten, mangelt es nicht, die Fachpresse ist voll davon. Auch als Sachbuch und im Kino bringt man uns die Thematik näher, zuletzt virtuos in „The Big Short“, der Verfilmung des Sachbuchs von Michael Lewis. Der Brite Darryl Cunningham nähert sich der Sache nun auch in Form der Graphic Novel „Supercrash“, deren Untertitel Programm ist: „How to hijack the global economy“, wie man sich die weltweite Wirtschaft unter den Nagel reißt, nichts weniger führt uns der Autor der hoch gelobten Comicromane „Psychiatric Tales“ und „Science Tales“ vor.
In drei groß angelegten Kapiteln legt er dar, wie amerikanische Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand den Boden für das ganze Unheil bereitete. In ihren Roman, allen voran „The Fountainhead“ und „Atlas Shrugged“, entwickelte sie nämlich die Theorie des Objektivismus – einer ausgeprägten Egozentrik, die besagt, dass jegliche staatliche Einmischung das Individuum beschränkt, dass schrankenlose Entfaltung in Form des Kapitalismus die natürliche Ordnung ist und die einzig sinnvolle Staatsform darstellt, in der sich die wirklich Talentierten durchsetzen und die Armen zu Recht als Unterschicht dahinvegetieren. Zum innigsten Verehrerkreis der militanten Dame, deren private Eskapaden Cunningham genüsslich ausbreitet, gehörte auch ein gewisser Alan Greenspan, unter dessen Führung die US-Notenbank in den 80ern gemeinsam mit der Regierung eine beispiellose Liberalisierung des Finanzsektors einleitete. Als dann im März 2000 die Internetblase platzte, pumpte Greenspan unbegrenzte Liquidität in den Markt, die dann anfing – wie das so üblich ist – Unfug zu machen, wie Cunnhingham das umfassend in Kapitel 2 beschreibt.
Angefeuert durch billige Kredite, erlebte der US-Immobilienmarkt einen beispiellosen Boom, in dem es bald weniger um solche langweiligen Dinge wie Eigenkapital und Bonität des Kreditnehmers ging, sondern darum, wie schnell das entsprechende Haus an Wert gewann und weiter beliehen werden konnte. So weit, so amerikanisch, so fremd für jeden schwäbisch-konservativen Häuslebauer, aber erst einmal ungefährlich für den Rest der Welt. Aber dann kamen die bösen Investmentbanken ins Spiel: die erfanden nämlich Mittel und Wege, die Kredite zu bündeln und weiterzuverkaufen. Auch das ist zunächst nicht schlimm, hypothekengesicherte Anleihen kennen wir hierzulande als Pfandbriefe, und das ist mit das ödeste und stocksolideste, was es in der Anlagewelt gibt. Denn Hypotheken werden ja zurückgezahlt. Wenn die Qualität stimmt. Und die stimmte ja auch. Anfangs. Aber dann ging alles den Bach runter: denn mit Krediten minderer Qualität lassen sich mehr Zinsen verdienen, weil hier das Risiko ja auch höher ist und bezahlt werden muss. Diese so genannten Subprime-Kredite – auf Deutsch also Hauskredite für Leute, die bei der Sparkasse um die Ecke noch nicht mal an den Geldautomaten dürften – wurden in die verkauften Pakete gemischt, die Rating-Agenturen gaben ihren Segen dazu, und Investoren rund um den Globus kauften gerne die bombensicheren Papiere.
Und es kam noch spaßiger: gleichzeitig wurden Instrumente ersonnen, mit denen man sich gegen den – natürlich vollkommen unwahrscheinlichen – Fall der Fälle versichern konnte. Diese Kreditausfallversicherungen (auf Neudeutsch CDS, Credit Default Swaps) waren für die Investmentbanken ebenso ein einträgliches Geschäft – ebenso (es wird immer besser, oder?) die rein synthetisch gebastelten Kreditpakete, die CDOs (collateralized debt obligations), mit denen man ganze Kreditpakete virtuell nachbildete und diese weiterverkaufte. Die ganze Suppe lagerte man dann aus der Bilanz aus in so genannte SPVs (special purpose vehicles), und – bleiben Sie bitte dabei, jetzt wird es brenzlig – als selbst in den USA nicht mehr genügend Käufer für den hübsch verpackten Ramsch aufzutreiben waren, sprangen gerne international „versierte“ „Finanzexperten“ wie deutsche Landesbanken, Städte und Gemeinden mit aufs Karussell. Irgendwann drehte sich das aber zu schnell, und wie der Reise nach Jerusalem gab es dann einige Akteure, die keinen Stuhl mehr erwischten, als die Musik aufhörte – wie z.B. der amerikanische Versicherungsriese AIG, der vielleicht ein paar CDS zu viel an Goldman Sachs verkauft hatte, die dann dummerweise auch noch darauf pochten, ihr Geld zu bekommen. Na so ein Ärger. Und die Lehmann Brüder, die nicht schnell genug die gestern noch hochwertigen, heute toxischen Papiere losgeschlagen hatten. Der Staat musste einspringen, damit nicht alles den Bach runterging, und schuld daran sind Alan Greenspan und Ayn Rand. Und das ist bis heute so, so informiert uns Herr Cunningham in letzten Teil, „Das Zeitalter der Selbstsucht“, einem flammenden Plädoyer für goldene Zeiten mit mehr Staat und weniger Bank.
Bestürzend und mitreißend entlarvt Cunningham die Mechanismen, die zu Neoliberalismus und Finanzkrise geführt haben, die maßlose Selbstsucht der geistigen Kinder von Ayn Rand, die sich mit der Gier rücksichtsloser Banker zu einer unheilvollen Mischung vereinte, die das Finanzsystem an den Rand des Abgrunds brachten und dabei auch noch Millionen scheffelten. Akribisch recherchiert, enthüllt Cunningham… bla bla bla. Ja, so in etwa gehen die Rezensionen auf dem Klappentext, so etwa soll man dieses Werk als aufrechter Leser wohl preisen, das 2015 offenbar ein New York Times Bestseller war. Mag sein, aber ich erlaube mir hier eine andere Sichtweise. Cunningham liefert nämlich nach meinen Dafürhalten hier eine höchst eigenwillige und einseitige Darlegung, der zufolge die Finanzkrise mehr oder weniger eigenhändig durch einen von Ayn Rand verwirrten Alan Greenspan ausgelöst wurde, der mit seinem Kumpel Hank Poulson (Chef von Goldman Sachs, später US-Finanzminister) dem Finanzwesen jegliche Zügel genommen hat und dadurch die Welt an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Und natürlich ist das bis heute so. Ah ja. Das Leben kann so einfach sein, es gibt die Guten und die Schlechten, wie im Märchen.
Klar ist: die Deregulierung ging zu weit, das System ist nicht perfekt, und einzelne Akteure haben sich alles andere als ehrenwert verhalten. Aber eine linke Polemik, die der Dominanz des Staates das Wort redet und den Kapitalismus in Bausch und Bogen verdammt, verkürzt die Sache genauso. Cunningham argumentiert geflissentlich, die Gier der Banken habe die Finanzkrise (ok) und damit auch die Euro-Krise ausgelöst (gar nicht ok): das ist natürlich schöner und einfacher als die unbequeme Sichtweise, dass die südeuropäischen Länder schlicht und ergreifend haltlos über ihre Verhältnisse gelebt haben und dafür jetzt die Rechnung auf dem Tisch liegt. Ebenso ausgeblendet ist die Erkenntnis, dass jedes Produkt einen Hersteller und einen Käufer braucht: wer sein Urteilsvermögen ausschaltet, einfach auf Ratings von irgendwelchen Agenturen vertraut und sich von der Aussicht auf die angeblich „todsichere“ Rendite einlullen lässt, darf sich nicht wundern, wenn das irgendwie nicht aufgeht. Und bevor hier jetzt der Ruf laut wird, das sei von einem Ahnungslosen leicht dahergeredet: ich habe die Lehmänner aus meinem Büro geschmissen, 2008, als sie mit hohen Provisionen und seltsamen Konstrukten winkten, und mich dafür als provinziell und konservativ beschimpfen lassen.
Aber das bin ich in solchen Fällen gerne, auch wenn Landesbanken (die gehörten schon immer dem Staat, mal ganz nebenbei) in der ganzen Republik das anders sehen wollten. Und Cunningham stellt die Banken als Verursacher der Kreditklemme dar, die doch eigentlich freigebiger sein sollten, um die Wirtschaft anzukurbeln – und wenn das geschieht, steht dann wieder der Vorwurf der unverantwortlichen Kreditvergabe im Raum. Cunninghams Traum der wohlwollenden Staatskontrolle mag man sehen, wie man möchte – ein ähnliches Experiment ist hierzulande glorios gescheitert, und wir zahlen es bis heute ab. Wo „The Big Short“ wunderbar, kritisch, unterhaltsam, lustig und spannend ist, liefert Cunningham eine grimmige linke Predigt, die noch nicht einmal die verwendeten Instrumente schlüssig erklärt (bei „The Big Short“ kann man die CDOs verstehen, hier kaum) – und dabei auch noch ziemlich platt, öde und plakativ-einfach gezeichnet daherkommt. Kritik am System ist wichtig, muss erlaubt sein, aber wer sich für die Thematik interessiert, dem sei Lewis‘ „The Big Short“ oder auch der schmissige Film „Margin Call“ ans Herz gelegt – und dass man kritisch, überlegt und vor allem gegen die Masse investieren sollte, das hat uns ja schon Herr Kostolany so amüsant wie lehrreich erklärt. In den 80ern. Lange vor der Ära der Finanzkrise. (hb)
Supercrash: Das Zeitalter der Selbstsucht
Text & Bilder: Darryl Cunningham
248 Seiten in Farbe, Softcover
Hanser Verlag
19,90 Euro
ISBN: 978-3-446-44698-4